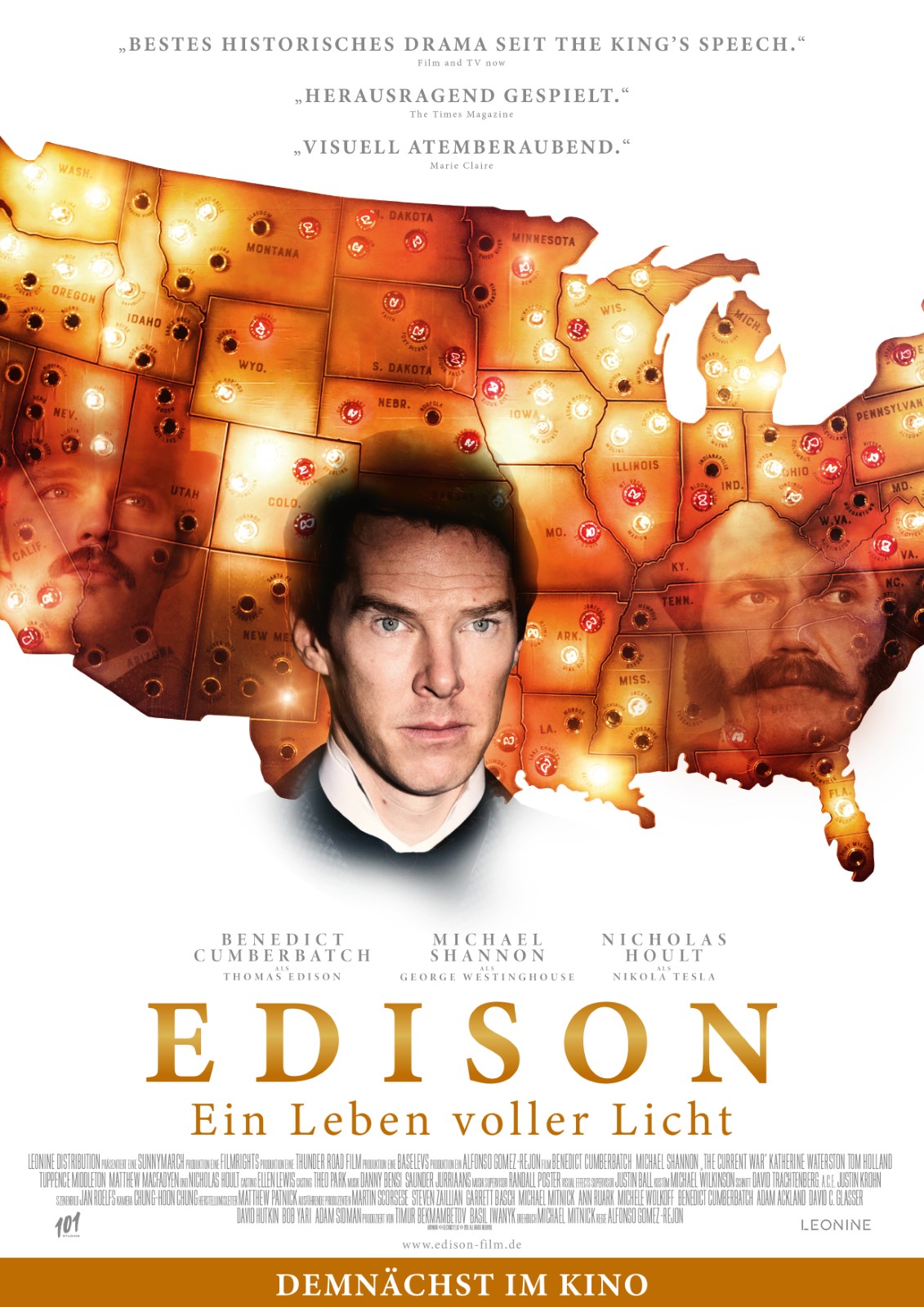LUCY IN THE SKY
Genre: Drama, SciFi
Regie: Noah Hawley
Cast: Natalie Portmann, Jon Hamm, Zazie Beetz
Laufzeit: 125 Minuten
FSK: ab 12 Jahre
Verleih: Walt Disney Germany
 |
| (c) Walt Disney Germany |
Inhalt:
Nach einer erfolgreichen Weltraum-Mission kehrt die junge Astronautin Lucy Cola (Natalie Portman) auf die Erde zurück. Doch seit sie die unendlichen Weiten des Alls mit all seiner Pracht bereist hat, ist sie verändert und beginnt, die Realität auf der Erde nicht mehr als solche wahrzunehmen. Sie fühlt sich ihrem eigenen, irdischen Leben und insbesondere ihrem Ehemann Drew (Dan Stevens) entrückt und leidet höchstwahrscheinlich an posttraumatischen Belastungsstörungen, weshalb sie sich in psychiatrische Hilfe begibt. Um aus ihrem tiefen Loch wieder herauszukommen, beginnt Lucy eine Affäre mit dem NASA-Kollegen Mark Goodwin (Jon Hamm), der sie, ihre Erfahrungen und ihre Probleme besser zu verstehen scheint. Doch als eine Konkurrentin um sein Herz auftaucht, übernimmt die Eifersucht Lucys ohnehin schon angeschlagenen Verstand.Bewertung:
Die Astronautin lächelt versonnen, als sie bei ihrem Spacewalk fast frei im Weltraum schwebt, nur mit einem langen Kabel am Shuttle vertäut. Nachdem sie von ihren Kollegen wieder reingezogen wurde, ist das Strahlen allerdings verschwunden. Teilnahmslos sitzt sie in ihrem Sessel, während das Raumschiff in die Atmosphäre eintritt und zur Landung ansetzt. Ihr nach der Rückkehr auf die Erde häufig eintretender emotionaler Nullzustand wird mit Hilfe meditativ anmutender Bilder von Kamerafrau Polly Morgan („A Quiet Place 2“), dem sphärischen Score von Jeff Russo („Mile 22“) sowie ein paar melancholisch-verträumten Popsongs zunächst noch effektiv illustriert.
Eine weitere wichtige Rolle spielt in diesen Situationen der Sound. Ein gutes Beispiel dafür ist die Szene, in der Lucy auf für sie schmerzhaft-peinliche Art von Marks Beziehung mit der von „Joker“-Co-Star Zazie Beetz verkörperten Erin erfährt. Das alles ist zusätzlich stressig für die junge Frau, weil sie bei ihrer ersten Begegnung dachte, dass Erin für sie eine Freundin, eine Schwester im Geiste werden könnte. Als sie dann aber realisiert, dass ihr Erin nicht nur den Liebhaber, sondern auch den Platz auf der so verzweifelt angestrebten Mission streitig machen könnte, bricht für Lucy eine Welt zusammen. Exakt hier ändern Regisseur Noah Hawley und Sound-Editor Justin M. Davey („A Quiet Place“) den regulären Klang in ein dumpfes, statisches Brummen, das die Stimmen und Umgebungsgeräusche nur entfernt wahrnehmbar macht.
Zudem lässt Hawley sein Publikum auch visuell zumindest ansatzweise mitfühlen, wie beengt, fast schon erdrückend Lucy ihren Alltag auf der Erde wahrnimmt: So ändert er etwa das Seitenverhältnis der Bilder, wenn sie auf die Erde zurückkommt. Aus dem ausladendem Cinemascope-Format (2.39:1) bei den visuell ein wenig an „Gravity“ erinnernden Weltraum-Sequenzen werden auf der Erde fast quadratische Bilder im 1.33:1-Verhältnis. Beim Astronauten-Training ist das Format dann zwischendurch schon wieder deutlich breiter (1.85:1), denn Lucy nähert sich spür- und sichtbar ihrem Element. Das ist ein simpler, zumindest am Anfang des Films noch gut funktionierender Trick, um den Zuschauer in die Gedanken- und Gefühlswelt der Protagonistin hineinzuziehen. Im späteren Verlauf beginnt das ständige Hin und Her der Formate, das Rauf und Runter der Geräuschkulisse dann jedoch zu nerven, auch weil das Konzept von Hawley & Co. nicht mehr stringent beibehalten wird. Selbst wenn es die Absicht war, so Lucys zunehmende Irrationalität in der zweiten Hälfte zu verdeutlichen, gelingt die Umsetzung nicht. Das Ganze wirkt eher zufällig und ist selbst mit gutem Willen irgendwann kaum mehr nachvollziehbar.
Dazu kommen immer evidenter werdende Drehbuchschwächen. Der früh absehbare Verlauf der Handlung wird durch aufdringliche Symbolik nicht interessanter. Zumal diese sehr klischeehaft daherkommt, etwa mit aus ihrem Kokon schlüpfenden Schmetterlingen als Bild der Selbstfindung oder einer startenden Rakete, die parallel zu Lucys Orgasmus beim Oralsex mit Mark geschnitten ist. Zu allem Überfluss ist das Story-Finale alles andere als befriedigend. Anstelle eines echten Höhepunkts kullert der so lange aufgebaute Moment einfach mäandernd in einer erzählerischen Sackgasse aus. Das Ende kann auch durch den wenig Sinn ergebenden Epilog, der sich ohnehin anfühlt, als würde er aus einem ganz anderen Film stammen, nicht mehr gerettet werden.
Schauspielerischen Enthusiasmus kann man Natalie Portman derweil nicht absprechen. In den intensiveren Szenen, wenn ihre Figur sich entschlossen hat, gegen die von ihr als Ungerechtigkeit oder gar als Verschwörung empfundene Situation am Arbeitsplatz und im Privaten anzukämpfen, setzt sie den starren Blick auf, den ihre Fans zuletzt aus ähnlich gearteten Bedrängungsszenarien wie „Vox Lux“ oder „Auslöschung“ kennen. Da fühlt man sich auch als Zuschauer so, als wolle man ihr in diesen Momenten vielleicht lieber nicht in die Quere kommen. Für Irritation sorgt dagegen ihr im Originalton ziemlich aufgesetzt und bemüht wirkender texanischer Akzent. Lucys geografische Herkunft spielt keinerlei Rolle und niemand anderes im Film spricht mit einem solch aufdringlichen Dialekt. Da wurde womöglich etwas zu sehr in Richtung Filmpreise geschielt.
Auch weitere Rollen sind namhaft besetzt. Doch die größeren Nebenfiguren wie Ehemann Drew, Nichte Iris oder Liebhaber Mark sind einfach zu schwach und eindimensional gezeichnet, um beim Zuschauer bleibenden Eindruck zu hinterlassen oder gar Emotionen zu erzeugen. Andere Parts zeigen da schon mehr Potenzial: Rivalin Erin, Lucys exzentrische Großmutter (Ellen Burstyn) oder der besorgte NASA-Psychiater bekommen allerdings viel zu wenig zu tun, um das Ruder noch rumzureißen. So schwebt der Zuschauer schon bald ebenso distanziert, gelangweilt und desinteressiert durch die sich mehr und mehr in die Länge ziehenden zwei Stunden, wie es die Hauptfigur nach ihrer Rückkehr auf die Erde ebenfalls tut…
Fazit:
Ein technisch einfallsreich sowie erzählerisch starker Beginn verspricht deutlich mehr, als das zunehmend immer fahriger wirkende und mit einer schwächelnden Story sowie allzu dünner Charakterzeichnung geschlagene Astronautinnen-Drama letztlich halten kann. Dafür können wir dann auch nur sternenlose 2 von 10 Punkte vergeben. (mk)